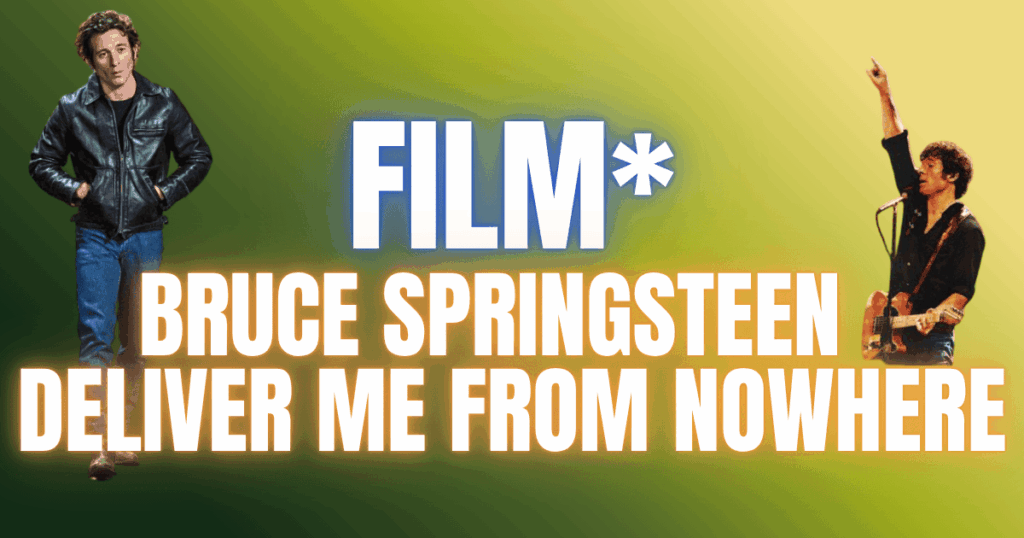Bruce Springsteen war für mich immer mehr Mythos als Mensch. Ein Name, der durch Gespräche geisterte, meist ausgesprochen mit diesem Unterton von Respekt, der keinen Widerspruch zulässt.
Ich kannte nur einige Lieder, zum Beispiel Born in the U.S.A oder Born to Run. Aber was ich kannte, war das Gefühl, das ihn umgab: Nostalgie. Vielleicht hat mich Deliver Me from Nowhere deshalb interessiert: ein Film, der nicht versucht, Springsteen zu glorifizieren, sondern der ihn in einem Moment zeigt, in dem alles still wird.
Im Schatten des eigenen Ruhms
Jeremy Allen White spielt Springsteen in den frühen Achtzigern, kurz nach seinem kommerziellen Durchbruch mit The River. Die Welt sieht in ihm einen Rockstar, er selbst fühlt sich leer. Der Film konzentriert sich auf die Entstehung von Nebraska, seinem sechsten Studioalbum, das 1982 erschien, aufgenommen allein, zu Hause, auf einem Vierspurgerät. Keine Band, keine Bühne, kein Publikum. Nur ein Mann, seine Gitarre und Geschichten, die sich anhören, als kämen sie aus der Dunkelheit.
Nebraska war ein Bruch. Die Songs handeln von Menschen, die am Rand leben: Bankräubern, Arbeitern, Mördern, einsamen Gestalten, die in einer Welt ohne Erlösung feststecken. In einer Szene sagt sein Produzent Jon Landau, gespielt von Jeremy Strong:
„These songs are about someone who feels condemned.“ (Diese Lieder handeln von jemandem, der sich verurteilt fühlt.)
Und das trifft nicht nur auf die Figuren zu, sondern auch auf den Zustand, von dem aus Springsteen damals schrieb. Das Gefühl, vom eigenen Erfolg verschluckt zu werden. Jeremy Strong kennt man vor allem aus Succession, wo er als Kendall Roy ständig zwischen Kontrolle und Chaos pendelt. Meist spielt er Männer, die unter Druck stehen, distanziert und schwer nahbar sind. In Deliver Me from Nowhere zeigt er zum ersten Mal eine andere Seite: ruhig, empathisch, fast zärtlich. Ohne viele Worte wirkt er hier plötzlich menschlich. Er ist einfach jemand, dem man glaubt.
„He’s afraid of success… you know, success is complicated for Bruce“ (Er hat Angst vor dem Erfolg … weißt du, Erfolg ist für Bruce eine komplizierte Sache), erklärt Landau später nochmals. Und man versteht, was gemeint ist: Erfolg ist für ihn keine Krönung, sondern eine Krise. Jeremy Allen White zeigt einen Mann, der mit Ruhm hadert, der ihn aber zugleich befreit und entfremdet. In jeder Geste liegt Zurückhaltung, fast Misstrauen gegenüber allem, was glänzt.

Zwischen Ohnmacht und Nähe
Der Film verwebt diese Phase mit Rückblenden in Springsteens Kindheit: den Vater, gespielt von Stephen Graham, der trinkt, gewalttätig ist und schweigt, und die Mutter, die das Leben aufrechterhält, aber darunter zerbricht. Es wird nie ausgesprochen, aber man spürt, dass diese Schwere geblieben ist – wie etwas, das sich nicht ganz abstreifen lässt, selbst wenn man längst erfolgreich ist.
Was mich beim Schauen beeindruckt hat, war, wie viel Verständnis der Film für seine Figuren hat. Niemand bleibt bloß Täter oder Opfer. Selbst der Vater, so brutal er manchmal ist, wirkt nicht wie ein Monster, sondern wie jemand, der mit sich selbst nicht zurechtkommt. Seine Gewalt entsteht aus Ohnmacht, nicht aus Bosheit. Der Film zwingt einen, das auszuhalten, ohne ihn zu entschuldigen.
Faye Romano, gespielt von Odessa Young, ist in diesem Geflecht so etwas wie ein Gegenpol. In ihren Szenen mit Springsteen und ihrer Tochter wird der Film wärmer, offener, fürsorglich. Da passiert nichts Großes, aber man spürt, dass Bruce sich in dieser Welt kurz sicher fühlt.
Wo Erschöpfung sichtbar wird
Sehr einprägsam war auch der Umgang mit Springsteens innerer Erschöpfung. Der Film benennt sie nie ausdrücklich, aber sie ist in jeder Szene spürbar: in den langen Pausen, im Blick, in der Art, wie Jeremy Allen White die Figur spielt. Diese Schwere hängt in der Luft, ohne dass jemand sie anspricht.
Erst im Abspann erfährt man, dass Springsteen in dieser Zeit mit einer Depression lebte. Rückblickend ergibt alles Sinn. Der Film vertraut darauf, dass man das selbst spürt, und das ist vielleicht das Mutigste daran. Männliche Verletzlichkeit wird hier nicht erklärt oder entschuldigt. Sie ist einfach da.

Intensiv und fast zu ruhig
Deliver Me from Nowhere ist ein ruhiger Film, manchmal fast zu ruhig. Er hat keine großen Spannungsbögen, keine typische Biopic-Struktur. Für Menschen, die Springsteen nicht kennen, bietet er wenig Orientierung. Aber vielleicht ist das Absicht. Der Film erklärt nicht, er beobachtet. Er will nicht zeigen, wie jemand berühmt wurde, sondern was davon übrig bleibt, wenn der Applaus verklungen ist.
Jeremy Allen White trägt das mit einer Intensität, die man kaum spielen kann. Sie wirkt echt. Kein Nachahmen, kein Idol. Nur ein Mensch, der versucht, in seiner eigenen Geschichte nicht unterzugehen.
Knister*Wissen: Ein Biopic ist ein Spielfilm, der das Leben einer realen Person erzählt, meist eine bekannte Figur aus Musik, Politik, Kultur oder Geschichte. Der Fokus liegt dabei nicht auf Fakten, sondern darauf, zentrale prägende Momente eines Lebens filmisch darzustellen.
Nur für Fans
Deliver Me from Nowhere ist definitiv kein Film für Nicht-Fans, und das ist vielleicht sein größtes Risiko. Wer Springsteen nicht kennt, findet kaum Halt, weil der Film vieles voraussetzt. Und das macht ihn ehrlich. Kein biografischer Abriss, kein Musikdrama, sondern ein stilles Porträt über Schuld, Erfolg und das Bedürfnis, überhaupt noch irgendwo dazuzugehören.
Ich ging aus dem Kino mit dem Gefühl, etwas verstanden zu haben, ohne genau zu wissen, was. Vielleicht, dass Erfolg nicht das Gegenteil von Einsamkeit ist. Vielleicht, dass selbst Legenden manchmal aussehen wie Menschen, die einfach nur ihre Wunden überleben.